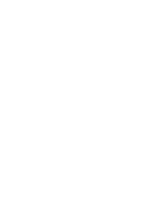Astrophysik – das ist kein Massenfach, bei dem Tausende Absolventinnen und Absolventen aus dem Studium strömen, sondern ein besonderes Fachgebiet. Physik und Mathe sind essentiell. Wer sich für dieses Fach entscheidet, übt sich gerne an komplexen naturwissenschaftlichen Fragestellungen oder startet einfach mit großer Neugier und Faszination für kosmische Objekte oder die Natur selbst. Doch was kommt nach dem Studium? Welche Wege sind möglich und was kann Astrophysik als Berufsfeld sein? Im Gespräch mit Philipp Richter, Professor für Astrophysik an der Universität Potsdam.

Prof. Dr. Philipp Richter
Philipp Richter lehrt seit 2007 an der Potsdamer Universität am Institut für Physik und Astronomie. Er forscht auf dem Gebiet der interstellaren und intergalaktischen Materie und lehrt im Bachelorstudiengang Physik sowie in den beiden Masterstudiengängen Physik und Astrophysics. Mit seiner Frau und seinen drei Kindern wohnt er in Berlin.
Wie kam es zu der Entscheidung, Astrophysiker zu werden?
Als ich in Marburg mit dem Physikstudium anfing, habe ich das erstmal nur für mich gemacht. Physik hat mich tatsächlich schon immer interessiert und ich wollte mir beweisen, dass ich dieses schwierige Studium bewältigen kann. Nach dem Vordiplom in Marburg habe ich mich dann für Bonn entschieden, weil man in Bonn Vorlesungen zur Astronomie bzw. Astrophysik belegen kann. Das hat mich wirklich gereizt. Ich fand es schon damals faszinierend, dass man mit den normalen Naturgesetzen, die hier auf der Erde gelten, eben auch kosmische Phänomene beschreiben kann, nur dass Zeitskalen und Dimensionen ganz Eigene sind. Die Astronomie ist ein Gebiet, in dem man – im Gegensatz zur Experimentalphysik – nichts anfassen kann, sondern anhand von physikalischen Gesetzmäßigkeiten und Konzepten Modelle entwickelt und schaut, ob das, was man beobachtet hat, mit diesen Modellen im Einklang steht. Man muss also sehr kreativ sein. Auch das fand ich spannend.
Sie haben nach dem Studium gleich promoviert. War der Weg in die Wissenschaft vorgezeichnet?
Es war nicht von vornherein klar, dass ich in die Wissenschaft gehe. Aber als ich dann meine Diplomarbeit zum Thema Kugelsternhaufen fertig geschrieben hatte, habe ich gleich das Angebot bekommen, eine Doktorarbeit zu schreiben, wenn auch auf einem anderen Gebiet, der UV-Astronomie. Meine Entscheidung fiel sehr schnell und ich habe auch in relativ kurzer Zeit promoviert, weil ich danach wiederum das Angebot hatte, für eine Postdoc-Stelle in die USA zu gehen. Die Arbeit in Wisconsin war sicher eine meiner produktivsten Zeiten. Über ein DFG-Stipendium bin ich danach direkt nach Florenz gegangen und habe dort noch eine ganze Weile eigenständig geforscht. Ich habe mir eigentlich immer nur zeitliche Limits für die einzelnen Karriereschritte gesetzt, in dem ich mir sagte: das forsche ich jetzt und dann gucken wir mal, was sich danach ergibt. Aber ich habe schon immer rechtzeitig im Auge behalten, ob sich ein Wechsel lohnt und wohin mich das Ganze führt.
War es für Sie leicht, eine Stelle in Deutschland zu finden?
Nun, ich musste mich intensiv bewerben. Und es war sicher auch ein bisschen Glück dabei. Aus Italien habe ich mich eher zufällig wieder nach Bonn zurückbeworben: dort war eine verbeamtete Mittelbau-Stelle frei. Eine echte Seltenheit, denn der Stellenmarkt war schon damals eher begrenzt. In Bonn habe ich dann meine erste eigene Arbeitsgruppe aufgebaut. Aber die wichtigste Entscheidung in meiner Karriere war sicherlich die, nach der Promotion in die USA zu gehen. Das war aber auch nicht so einfach. Ich war ja damals schon mit meiner heutigen Frau liiert und wir mussten gemeinsam entscheiden, ob und wohin ich ohne sie für mehrere Jahre ins Ausland ziehe, denn meine Frau ist als Rechtsanwältin beruflich an Deutschland gebunden. Wir wussten, dass das schwierig werden kann mit einer Fernbeziehung, aber wir haben es riskiert und es hat hervorragend geklappt. Wir haben uns in dieser Zeit extrem fortentwickelt, allein und auch als Paar. Nachdem wir in Bonn wieder zusammengezogen sind, waren wir uns einig darin, dass ab nun derjenige, der den besseren Job findet, entscheidet, wo es hingeht. Ich bin dann mit meiner Familie 2007 dem Ruf als Professor gefolgt – hierher nach Potsdam.
Welche Aufgaben haben Sie als Professor der Astrophysik an der Universität?
Zum einen unterrichte ich die Studierenden. Ich gebe Astrophysik-Vorlesungen und lehre auch in der Experimentalphysik. Natürlich gehören dann auch die Prüfungen dazu. Das macht mir alles ziemlich viel Spaß. Ich würde sagen, die Lehre macht ungefähr ein Drittel meiner Arbeit aus. Was sich davon noch ein bisschen absetzt, ist die Betreuung der Studierenden und Doktoranden. Viel Raum nehmen noch die Gremienarbeit und die Verwaltung ein, zusammen bestimmt 40 Prozent. Das frisst also schon einen großen Teil der Zeit auf. Für die eigentliche Forschung bleiben dann zirka 20 Prozent. Ich versuche, mir dafür Auszeiten zu nehmen. Zeiten, in denen ich dann tatsächlich selber programmiere und auch die Daten auswerte. Eine eigene wissenschaftliche Publikation pro Jahr, das ist nach wie vor mein Ziel.
Die Vorstellung vom sternguckenden Wissenschaftler scheint heute ein wenig überholt. Wie würden Sie die astrophysikalische Forschung beschreiben?
In der Astrophysik verschwimmen die Grenzen heute. Das heißt, dass man gar nicht mehr so klassisch unterscheiden kann zwischen theoretischer und beobachtender Astrophysik, so, wie das früher der Fall war. Jeder, der zum Beispiel das Hubble-Teleskop für Beobachtungen nutzt, ist eigentlich auch Theoretiker, weil er Modelle für die Interpretation der Beobachtungen braucht. Diese muss man ja auch als Beobachter physikalisch durchdringen. Insofern sind immer mehr theoretische Aspekte dazugekommen.
Spiegelt sich diese Entwicklung auch in Ihrer eigenen Arbeit wider?
Ich bin schon noch beobachtungsorientiert. Das heißt, ich fange mit Beobachtungsdaten an, die ich dann physikalisch auszuwerten versuche. Aber aktiv beobachten am Teleskop, das war ich länger nicht mehr. Das hat aber nicht nur damit zu tun, dass ich jetzt Professor bin, sondern vor allem damit, dass die gesamte beobachtende Astronomie immer vielschichtiger wird. Die großen modernen Teleskope sind extrem komplex geworden. So, wie ich es selbst gelernt habe, dass man eigenhändig mit einem Teleskop arbeitet und alles selber macht: in die Kuppel geht und alles einstellt, die Instrumente kühlt und so weiter, das ist selten geworden. An den internationalen Großteleskopen arbeitet heutzutage ein riesiges Team. Man kommt teilweise selbst gar nicht mehr in die Kuppel hinein, aus verschiedenen Gründen. Man überwacht sozusagen nur die Beobachtung. Aber es ist ja auch eine Aufwands- und Geldfrage, ob man das überhaupt noch selbst vor Ort machen muss, wenn ich da zum Bespiel an die Teleskope in Chile denke. Man könnte also sagen: wir sind Opfer unserer eigenen Fortentwicklung. Aber den romantischen Astronomen, der an einem Teleskop sitzt, den gibt es bei uns auch noch, nämlich wenn ich Praktika mache oder Schülergruppen nachts an unserem Potsdamer Teleskop die Sterne und die Planeten zeige. Aber in meiner eigenen Forschung taucht das praktische Beobachten immer seltener auf.
Was würden Sie sagen: welche Eigenschaften oder Fähigkeiten sollte ein angehender Astrophysiker heute mitbringen?
Für das Studium der Physik oder Astrophysik sollte man auf jeden Fall viel Neugier mitbringen. Und man braucht sicherlich ein großes Durchhaltevermögen. Es ist wirklich kein leichtes Studium – es ist intellektuell sehr anspruchsvoll und man muss auch damit rechnen, dass man zwischendurch scheitert, z.B. in Klausuren oder Prüfungen. Ich denke außerdem, dass eine gute Zeiteinteilung wichtig ist. Gerade bei dem heutigen Studiensystem mit dem Bachelor und Master ist eine Menge Selbstorganisation gefordert. Diese Formalia sollte man im Griff haben. Aber wenn man das alles geschafft hat, ist man hervorragend für ein Berufsleben vorbereitet. Aber jeder Student tickt anders und bringt andere Voraussetzungen mit. Ich versuche deshalb, in der Lehre einen roten Faden zu spinnen und die Grundideen des Fachs so zu vermitteln, dass die Studierenden entlang der entwickelten Pfade eigene Querverbindungen ziehen können. Physik durchdringt alles um uns herum, man muss nur genauer hinschauen. Durch diese Art von Querverbindungen bekommt man ein intuitives Gefühl für Physik, für tiefere physikalische Zusammenhänge. Und das ist extrem wichtig für die Karriere als Forscher. Man sollte außerdem kreativ sein und in der Lage sein, Ideen und physikalisch relevante Szenarien – auch jenseits des Mainstream – selber zu entwickeln.
Und nach dem Studium?
Flexibilität ist und bleibt wichtig. Dazu gehört auch eine Zeit im Ausland: zum Lernen, Vernetzen und auch, um sich für den begrenzten Arbeitsmarkt in Deutschland interessant zu machen, wenn man in Deutschland arbeiten möchte. Dabei muss man nicht unbedingt im Ausland promovieren. Das kann zeitlich gesehen unter Umständen sogar gar nicht so sinnvoll sein. Aber eine gewisse Flexibilität braucht es in jedem Fall. Der Wissenschaftsbetrieb funktioniert in manchen Ländern auch anders als hier. Wobei das natürlich auch sehr von der Hochschule und den Leuten abhängt. Mit Flexibilität meine ich übrigens auch eine gewisse Mobilität innerhalb des Fachs. Ich habe zum Beispiel in meiner USA-Zeit mit einem UV-Satelliten gearbeitet und habe mich dann parallel ein bisschen umorientiert. Die UV-Astronomie stand zu der Zeit ein wenig auf der Kippe. Der Satellit, der damals die Hauptdaten geliefert hat, hatte eine begrenzte Lebensdauer und es war nicht klar, ob es nach dieser Mission eine weitere UV-Mission geben würde und ob mein Forschungsgebiet überleben würde. Also bin ich mehrgleisig gefahren. Und nicht zuletzt: ich finde man sollte auch kommunikativ sein als Forscher und mit Leuten ins Gespräch kommen. Erst in der Diskussion über ein wissenschaftliches Thema entwickeln sich neue Ideen. Manchmal helfen einem Kollegen weiter, zum Beispiel mit mathematischen Methoden. Sich ins Kämmerlein einzuschließen und zu denken „Ich bastele jetzt an meiner Karriere“, das funktioniert nicht.
Sie sind der Wissenschaft treu geblieben. Dennoch: gab es da mal einen Punkt, an dem Sie über Alternativen nachgedacht haben?
Bevor ich aus Italien nach Deutschland zurückgekehrt bin, habe ich mir schon überlegt, was ich mache, wenn das jetzt mit der nächsten Stelle nicht klappt. Wo heuere ich dann vielleicht in der Wirtschaft an? Ich hatte allerdings auch keine feste Vorstellung für einen Plan B. Es ist aber nicht konkret zu dem Punkt gekommen, dass ich mich aus der Wissenschaft wegbegeben wollte. Ich hatte mir eher ein Alterslimit gesetzt. Und wie gesagt: am Ende war sicher auch eine Portion Glück dabei, dass ich Wissenschaftler bleiben durfte.
Vielen Dank für das Gespräch.
Das Interview führte Christine Kreutzer von science³ - Agentur für Wissenschaftskommunikation.
Lesen Sie mehr zum Berufsfeld Astrophysik in einem Interview mit Prof. Dr. Stephan Geier.